„Kauf auf Rechnung“ ist eine bei Kunden von Onlineshops beliebte Zahlungsart, da diese im Normalfall erst nach Warenerhalt bezahlen müssen, was eine höhere Sicherheit bietet. Aufgrund des damit für den Onlinehändler verbundenen Risikos ist hierfür jedoch oft eine Bonitätsprüfung notwendig. Ein kürzlich ergangenes Urteil des Bundesgerichtshofs klärte offene Fragen darüber, wie darüber informiert werden muss.
Was der BGH entschied und welche Rolle der Europäische Gerichtshof dabei spielte, erfahren Sie im folgenden Beitrag.
Der Sachverhalt
Der Onlinehändler Bonprix hatte auf seiner Webseite im Header prominent mit „Bequemer Kauf auf Rechnung“ geworben.
Ein Wettbewerbsverein mahnte diese Werbung erfolglos ab, da sie seiner Meinung nach irreführend war, da sich daraus nicht ergab, dass die Nutzung der Zahlart „Kauf auf Rechnung“ eine positive Kreditwürdigkeitsprüfung voraussetzt.
Vor dem Landgericht Hamburg (Urt. vom 21.07.22, Az.: 403 HKO 37/22) wurde die Klage abgewiesen.
Die Richter befanden, dass „Bequemer Kauf auf Rechnung“ im allgemeinen Verkehr nicht so verstanden würde, dass die Zahlart „Rechnung“ jedem ausnahmslos angeboten würde.
Es sei stattdessen allgemein bekannt, dass Zahlungsweisen wie „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenzahlung“ eine entsprechende Bonität voraussetzen.
Auch die Berufung vor dem Oberlandesgericht Hamburg (Urt. vom 9. Januar 2023, Az: 15 U 75/22) blieb ohne Erfolg.
EUGH-Vorlage
Um in der Revision über den Fall zu entscheiden, stellte der Bundesgerichtshof (BGH) die folgende Frage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH):
„Stellt die Werbung mit einer Zahlungsmodalität (hier: „Bequemer Kauf auf Rechnung“), die zwar nur einen geringen Geldwert hat, jedoch dem Sicherheits- und Rechtsinteresse des Verbrauchers dient (hier: keine Preisgabe sensibler Zahlungsdaten, bei Rückabwicklung des Vertrags keine Rückforderung einer Vorleistung), ein Angebot zur Verkaufsförderung im Sinne des Art. 6 Buchst. c der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr dar?“
Der relevante Artikelteil der europäischen Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr besagt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass bei Werbung im Internet zulässige Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke klar erkennbar sind und die Bedingungen ihrer Inanspruchnahme leicht zugänglich, klar und unzweideutig angegeben werden.
Der EuGH antwortete mit seinem Urteil vom 15. Mai 2025 (C-100/24), dieser Artikel sei so auszulegen:
„Eine Werbeaussage auf der Website eines im Onlinehandel tätigen Unternehmens, mit der auf eine bestimmte Zahlungsmodalität hingewiesen wird, fällt unter den Begriff ‚Angebot zur Verkaufsförderung‘ im Sinne dieser Bestimmung, sofern diese Zahlungsmodalität dem Adressaten dieser Aussage einen objektiven und sicheren Vorteil verschafft, der sein Verhalten bei der Entscheidung für eine Ware oder Dienstleistung beeinflussen kann.“
Auf dieser Grundlage gab der Senat des Bundesgerichtshofs der Revision statt und wies den Rechtsfall zurück an das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg.
Die BGH-Vorgaben
Das OLG Hamburg hatte angenommen, die Werbung „Bequemer Kauf auf Rechnung“ sei nicht irreführend, da der Verbraucher lediglich erkenne, dass „Kauf auf Rechnung“ eine mögliche Zahlart sei, und er nicht sämtliche Bedingungen und Details eines Kaufs auf Rechnung erwarte.
Es handele sich nicht um Blickfangwerbung, da sie nicht hervorgehoben sei. Der Verbraucher werde nicht auf eine sensationelle oder außergewöhnliche Aussage gelenkt. Es wäre sogar außergewöhnlich, wenn die Zahlart Rechnung nicht mit Bedingungen verknüpft wäre.
Im Bestellverlauf wurden die Bedingungen des Rechnungskaufs dargestellt.
Diese und weitere Ausführungen akzeptierten die Richter des BGH, sodass auch sie annahmen, dass keine Irreführung vorläge.
Anders als die Hanseatischen Richter sah der Senat jedoch potenziell Informationspflichten verletzt.
Denn in § 6 (1) 3. TMG ist auf Basis der vorgenannten Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr klargestellt,
dass Diensteanbieter bei kommerziellen Kommunikationen, welche Telemedien oder Bestandteile davon sind, die Voraussetzungen erfüllen müssen, dass
Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke klar als solche erkennbar sind und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme leicht zugänglich sowie klar und unzweideutig angegeben werden.
Bonprix ist als Onlinehändler ein Diensteanbieter und der Online-Versandhandel ein Telemedium.
Ebenso stellt die Aussage „Bequemer Kauf auf Rechnung” eine kommerzielle Kommunikation als Bestandteil des Telemediums dar.
Nach Ansicht des BGH ist es denkbar, dass diese Angabe auch ein Angebot zur Verkaufsförderung darstellt. Dies muss das OLG Hamburg, an welches der Fall zurückverwiesen wird, erneut prüfen.
Aus der Antwort des EuGH ergibt sich, dass eine Werbeaussage über eine bestimmte Zahlungsmodalität ein „Angebot zur Verkaufsförderung“ sein kann, sofern diese dem Käufer einen objektiven, sicheren Vorteil verschafft, der sein Verhalten bei der Entscheidung für eine Ware oder Dienstleistung beeinflussen kann.
Mit dem Kauf auf Rechnung erhält der Käufer einen, wenn auch geringfügigen, geldwerten Vorteil, da er den Kaufpreis erst später entrichten muss und somit einen Liquiditätsvorschuss hat.
Wie auch der EuGH andeutete, könnten solche Umstände einen Käufer dazu bewegen, sich für einen Verkäufer zu entscheiden, der die Zahlart „Kauf auf Rechnung“ anbietet, anstatt für einen, der nur Zahlarten mit sofortiger Wirkung vorweist.
Zwar liegt die endgültige Entscheidung beim Oberlandesgericht Hamburg, für den Bundesgerichtshof sprach jedoch vieles dafür, dass das Angebot eine verkaufsfördernde Wirkung hat und dabei die Informationspflichten verletzt wurden.
Denn die Bedingungen der Inanspruchnahme, also der Vorbehalt der Prüfung der Kreditwürdigkeit, wären nicht leicht zugänglich. Dies könnte bei Angeboten im Internet leicht über einen Link geschehen. Ohne weitere Informationen kann vom Verbraucher nicht erwartet werden, dass er nach weiteren Informationen Ausschau hält.
Es ist wahrscheinlich, dass der „bequeme Kauf auf Rechnung“ den Verbraucher dazu animiert, einen Bestellvorgang einzuleiten, und er somit zu einer geschäftlichen Entscheidung bewegt wird.
Dass im Bestellverlauf über die Bedingungen aufgeklärt wird, ändert daran nichts, da dies zu spät geschieht. Der Verbraucher muss informiert werden, bevor er seine geschäftliche Entscheidung trifft, die er bereits mit Einleitung des Bestellvorgangs getroffen hat.
Fazit:
Auch wenn der Sachverhalt erneut durch das Hanseatische Oberlandesgericht geprüft werden muss, hat der Bundesgerichtshof relativ klare Vorgaben gemacht:
Wer mit Zahlungsmodalitäten wie „Bequemer Kauf auf Rechnung“, die an Bedingungen wie etwa einer Kreditwürdigkeitsprüfung geknüpft sind, wirbt, sollte daher
entweder direkt an der Stelle der Werbeaussage oder dort klar und deutlich auf die damit verbundenen Bedingungen verlinken.
Kunden von Protected Shops finden die Bedingungen relevanter Zahlarten in ihren Rechtstexten aufgeführt, sodass sie an entsprechender Stelle eingefügt oder darauf verlinkt werden können.


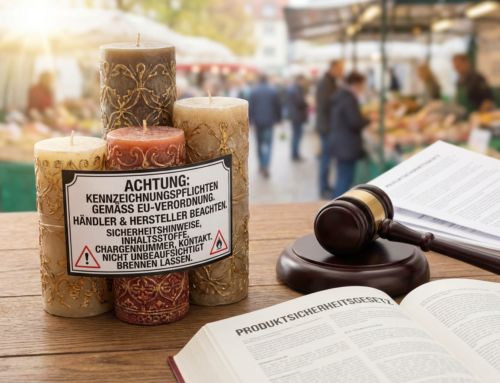

![Achtung! Weitere neue Verpflichtungen ab Dezember: EU-Verordnung über entwaldungsfreie Landwirtschaftsprodukte [UPDATE 01.12.2025]](https://www.protectedshops.de/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/Entwaldungsfrei-500x383.jpeg)
